Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung? Woran erkennt man sie? Wie behandelt man sie?
Der Begriff Posttraumatische Belastungsstörung (im Folgenden auch PTBS) bringt bereits zum Ausdruck, worum es sich handelt: Es handelt sich um eine Erkrankung, die verzögert als Folge eines Traumas bzw. einer Traumatisierung auftritt.
Ein Trauma entsteht, wenn Betroffene sich in einer extremen, katastrophenartigen Situation der Bedrohung wiederfinden, in der sie sich voller Angst, schutzlos, ausgeliefert und ohne Kontrolle erleben. Sie sehen sich selbst als handlungsunfähig und ihre persönlichen Bewältigungsstrategien reichen nicht aus, um mit dem Ereignis fertig zu werden. Beispiele: Naturkatastrophen, Gewalterfahrungen, Unfälle oder ähnliche gravierende Veränderungen im eigenen Leben und Umfeld.
Wird dieses Trauma nicht bewältigt, kann es in der Folge zu Flashbacks, unwillkürlichen Erinnerungen, intrusiven, sich aufdrängenden Gedanken, ständigem Wiedererleben, Tagträumen und nachts zu Angstträumen / Albträumen kommen (siehe Angstträume). Dies wiederum zieht eine Reihe von gesundheitlichen Folgen nach sich, die es zu vermeiden gilt. Im schlimmsten Falle werden Betroffen arbeitsunfähig, da die seelischen Belastungen zu stark werden. Selbst der Alltag gestaltet sich dann als Qual.

In seltenen Fällen kann sich die Erkrankung auch noch Jahrzehnte nach dem traumatischen Ereignis entwickeln. Das macht es dann schwierig, die gesundheitlichen Einschränkungen richtig einzuordnen und die Ursache ausfindig zu machen.
In manchen Fällen sind auch Personen von einer PTBS betroffen, die miterleben müssen, wie sich Andere sich in einer existenziellen Bedrohungssituation wiedergefunden haben. Ein Beispiel hierfür sind Rettungshelfer oder Augenzeugen von Gewaltverbrechen. Das Welt- und Selbstverständnis wird infolgedessen grundlegend erschüttert: Danach ist nichts mehr, wie es zuvor war.
Symptome von traumatischen Störungen
Neben den typischen Merkmalen des unwillkürlichen Wiedererlebens, die für die Betroffenen ein starkes Leiden bedeuten, stehen auf der anderen Seite die sogenannten Vermeidungssymptome (vgl. Vermeidungsverhalten / Vermeidungsstrategien): Alles, was im Entferntesten an das Trauma erinnern könnte, wird von den Patienten oft vermieden, um nicht wieder eine Erinnerung aufkommen zu lassen.
Zudem entwickelt sich häufig eine emotionale Abgestumpftheit und eine ausgeprägte Gleichgültigkeit der Umgebung und anderen Menschen gegenüber. Dies sind ebenfalls Merkmale bzw. Symptome der PTBS.
Auch das vegetative Nervensystem reagiert übererregt, was sich in Schlafstörungen (u.a. Durchschlafstörungen) oder Schlaflosigkeit, ausgeprägter Schreckhaftigkeit und Wachsamkeit, Nervosität, Reizbarkeit und Aggressivität und mangelndem Konzentrationsvermögen niederschlägt (siehe auch vegetatives Nervensystem beruhigen).
Die Merkmale können dabei unspezifisch wirken, da sich sehr häufig (in 90 Prozent der Fälle) über die Wochen und Monate noch andere psychische Krankheitsbilder zusätzlich entwickeln: Beispiele hierfür sind Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen wie Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit. Man spricht in der psychiatrischen Fachterminologie dann von Komorbiditäten. Komorbiditäten bedeuten, dass nicht nur ein Krankheitsbild vorhanden ist, sondern sich verschiedene körperliche und/oder psychiatrische Krankheitsbilder miteinander mischen (siehe Komorbidität Definition). Insbesondere Depressivität, Sucht und PTBS verbinden sich oft miteinander und verstärken sich gegenseitig. Patienten empfinden oft eine tiefe Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit, Hilflosigkeit und innere Leere. Dieser Zustand ist mit depressiven Elementen verwandt. Häufig greifen Patienten dann zu Suchtmitteln, um sich in einer Art Eigentherapie selbst zu helfen und dem Leidensdruck zu entkommen.
Posttraumatische Belastungsstörung Symptome: Zusammenfassung
- Körperliche Angespanntheit
- Flashbacks und sich aufdrängende Erinnerungsfetzen
- Misstrauen und Feindseligkeit
- erhöhte Wachsamkeit
- somatische Beschwerden
- Schlafstörungen
- vegetative Übererregung
- depressive Elemente, Angst und Sucht
- emotionale Abgestumpftheit
- Gleichgültigkeit gegenüber Umwelt und Mitmenschen
- Vermeidung / Vermeidungsverhalten
- Gefühl von Hilflosigkeit dem Erlebten gegenüber

Posttraumatische Reaktionen und ihre Ursachen
Auslöser für solche Belastungsstörungen können verschiedene Ereignisse mit katastrophenartigem Charakter sein:
- Vergewaltigung,
- anhaltender sexueller Missbrauch,
- andere Formen von Gewalt (zum Beispiel emotionale Gewalt),
- Geiselhaft,
- sehr starker Stress bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebs oder Herzinfarkt,
- Naturkatastrophen wie Erdbeben, Lawinen oder Überschwemmungen,
- von Menschen ausgelöste Katastrophen wie Brände oder Flugzeugabstürze und vor allem
- Krieg und Kriegsgefangenschaft sind typische Ursachen.
Ursprünglich wurde das Phänomen dadurch entdeckt, dass Soldaten, die aus dem Vietnamkrieg zurückkehrten, im weiteren Verlauf ihres Lebens die beschriebenen Symptome entwickelten. Auf diese Weise kam man den Auslösern auf die Spur. So weiß man inzwischen auch, dass viele Soldaten der Bundeswehr, die aus Einsätzen in Regionen zurückkehren, in denen Krieg herrscht oder herrschte (zum Beispiel Kosovo, Afghanistan, Irak etc.), eine PTBS entwickeln und ausgeprägte Zeichen von Angst und andere Beeinträchtigungen zeigen. Die Bundeswehr hat deswegen inzwischen Hilfsmodelle für geschädigte Soldaten entwickelt. Dies gilt insbesondere dann, wenn ehemalige Angehörige der Bundeswehr durch die Folgen einer PTBS arbeitsunfähig werden. So bietet das Bundesministerium für Verteidigung beispielsweise Kontaktmöglichkeiten an: https://ptbs-hilfe.de/service/ansprechpartner.html
Es existiert sogar ein Beauftragter für Posttraumatische Belastungsstörungen und im weiteren Sinne Einsatzgeschädigte: https://www.bundeswehr-support.de/bws/ansprechstellen/beauftragter-fuer-ptbs-und-einsatzgeschaedigte.html
Da das Phänomen inzwischen bekannt ist, erhalten besonders gefährdete Personengruppen meist (aber nicht immer) Hilfe. Bei den Veteranen des Vietnamkrieges war dies beispielsweise noch nicht der Fall. Die schwerste Form eines Traumas ist jedoch eine Vergewaltigung. Eine solche körperliche Gewalterfahrung zieht fast immer traumatische Reaktionen nach sich.
Diagnostik nach ICD 10 Kriterien
Die Diagnostik obliegt einem Psychiater bzw. Neurologen. Die Diagnose wird dabei gemäß ICD 10 gestellt (der zehnten Ausgabe des International Code of Diseases der WHO).
Psychiater und Neurologen, die zumeist beides in einem sind, prüfen in Gesprächen und Tests die Erinnerung von Betroffenen und ob ein bestimmtes Ereignis (Unfall, Naturkatastrophe) oder Erlebnis von Gewalt in irgendeiner Form der Situation zugrunde liegt. Opfern von Gewalt wird diese Diagnose nach Auswertung der Gespräche und Tests oft gestellt. Circa ein Drittel der Menschen, die ein Trauma erlebt haben, entwickelt eine posttraumatische Störung. Das Auftreten von PTBS beträgt statistisch weltweit etwa acht Prozent.
Nach der Diagnostik richtet sich die therapeutische Betreuung der Störungen, die bei jedem etwas unterschiedlich ausgeprägt sein können (vgl. posttraumatische Depression, posttraumatische Verbitterungsstörung, posttraumatisches Syndrom).
Es gibt dabei verschiedene Therapieformen. Psychiater sind zumeist ebenfalls Neurologen, da die Übergänge beider Fachgebiete fließend sind. Jedoch befasst sich die Neurologie speziell mit der Lehre und den Erkrankungen des Nervensystems. Solche Belastungsstörungen sind deswegen weniger eine Aufgabe der Neurologie als vielmehr eine Aufgabe der psychiatrischen bzw. psychologischen Disziplin. Wichtig ist es, die Beschwerden von anderen Krankheitsbildern abzugrenzen und klar als solche zu erkennen, denn verschiedene Symptome der Störung treten auch bei anderen psychischen Erkrankungen auf (siehe auch: Anpassungsstörung, Somatisierungsstörungen Symptome, reaktive Depression). Im ICD 10 ist die posttraumatische Belastungsstörung unter F43.1 kodiert.
PTBS Therapie
Opfer, die ein schlimmes Erlebnis wie Krieg, Erdbeben, Unfälle, eine Vergewaltigung oder ähnliche Gewalterfahrungen hinter sich haben, haben unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung.
- Im akuten Stadium erfolgt häufig eine Einweisung in die Psychiatrie. Jedoch kann die Psychiatrie lediglich der akuten Stabilisierung (beispielsweise bei Selbstmordgefährdung, siehe Suizid Gedanken) dienen und eventuell einer medikamentösen Einstellung, um schwerwiegende Einschränkungen zu vermeiden und zu behandeln.
- Wichtiger ist die psychologische / pychosomatische Behandlung, die häufig ebenfalls in einer Klinik stattfindet, aber langfristig auch ambulant in einer Praxis durchgeführt werden kann. Dabei geht es darum, den seelischen Stress durch das erlebte Ereignis, das die Extrembelastung hervorgerufen hat, aufzuarbeiten und die Patienten dazu anzuleiten, wieder ein normales Leben zu führen und im Alltag erneut Fuß zu fassen. Der Aspekt der Psychosomatik ist hier in der Regel stark in der Fokus zu nehmen; eine psychiatrische Klinik und Medikamente nur ein Mittel der zweiten Wahl.
Fazit: Der Schwerpunkt der längerfristigen Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung liegt in der Psychotherapie. Dies wiederum bedeutet Gesprächstherapie, wobei es unterschiedliche Formen gibt; siehe Gesprächstherapien sowie Psychotherapien im Überblick. – Die psychotherapeutische Behandlung zielt darauf ab, eine Traumatisierung und seelischen Stress, der durch eine existenzielle Bedrohung entstanden ist, aufzulösen.
Ziel ist es dabei,
- seelische Belastungen abbauen und den
- Leidensdruck der Opfer zu vermindern.
Therapeuten, die mit PTBS-Patienten arbeiten, sind meist Therapeuten, die sich mit Traumata auskennen. Eine Behandlung ist in solchen Fällen deswegen im Grunde genommen eine Traumatherapie. Eine Verhaltenstherapie wiederum ist bei dieser Krankheit kontraindiziert. Häufig(er) zum Einsatz kommt das EMDR-Verfahren (siehe EMDR)
Damit die Psychotherapie Erfolg zeigt, ist es notwendig, einen sicheren, Vertrauen erweckenden Rahmen zu schaffen, in dem sich der Patient mit gutem Gefühl öffnen kann. Es liegt in der Natur der Sache, dass es schwierig ist, über Traumata zu sprechen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient muss deswegen stimmig sein, der Patient muss sich sicher und gut aufgehoben fühlen.
Im weiteren Verlauf der therapeutischen Behandlung geht es darum, den Patienten ein Instrumentarium zu vermitteln, wie sie mit ihren Gefühlen und Flashbacks besser umgehen und das Alltagsleben somit wieder besser bewältigen können. Ziel ist es, wieder eine normale Lebensbewältigung zu ermöglichen (vgl. Angstbewältigung). Da Patienten häufig aus der beruflichen Laufbahn geworden werden, ist unter Umständen die Ausarbeitung einer beruflichen Neuorientierung notwendig.
Heilungsaussichten
Die Heilungsaussichten für sind statistisch gesehen recht gut. In der Mehrzahl der Fälle klingt das Störungsbild wieder ab. Dies gilt insbesondere dann, wenn Betroffene eine angemessene Behandlung in Form einer Traumatherapie erfahren, die in der Regel zwei Jahre umfasst. Wie erwähnt spielt auch EMDR als Verfahren eine etablierte Rolle.
Die Hälfte der Betroffenen wird sogar ohne Behandlung wieder gesund, wobei man hier von einer sogenannten Spontanremission spricht: das heißt, die Symptome bilden sich nach einer gewissen Zeit von selbst zurück, wenn die Patienten genügend Abstand von ihren schlimmen Erfahrungen haben und wieder Fuß gefasst haben.
Jedoch droht ohne Behandlung die Gefahr einer Chronifizierung: Bestehen traumatische Beschwerden über Jahre hinweg, wird sie bei etwa einem Drittel der Patienten chronisch. Das bedeutet: Sie wird zum dauerhaften, anhaltenden Zustandsbild. Deswegen ist es wichtig, die Situation im Auftreten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um das Leiden der Patienten zu minimieren, abzubauen und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Auch vegetative Symptome legen sich dann meist wieder.
Die Heilungschancen sind also bei adäquater Behandlung recht gut und die Einschränkungen durch die Extrembelastung können wieder abklingen. Wichtig ist es dabei auch, parallel auftretende Krankheiten wie Sucht ebenfalls zu behandeln.
Die Heilungsaussichten für traumatische Belastungsstörungen sind umso besser, wenn Menschen mit Traumata Unterstützung durch ihre nächste Umgebung (Familie, Verwandte und Freunde) erhalten. Hilfreich kann auch der Kontakt zu einer Opferschutzorganisation sein (bei Gewaltopfern beispielsweise der „Weiße Ring“, weisser-ring.de).
Auch eine gute materielle Absicherung ist günstig für die Prognose. Dies weiß man ebenfalls durch die Erfahrung mit Vietnam-Veteranen, die häufig mangels Unterstützung in Armut, Einsamkeit und Sucht abstürzten.
Nachteilig für die Entwicklung und die Behandlung wirken sich ein sehr jugendliches oder hohes Alter sowie die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht aus oder wenn in der Vorgeschichte bereits eine psychische Erkrankung vorhanden war. Über die Hälfte der Patienten sind Frauen. Zumindest Statistiken zeigen, dass diese Personengruppen besonderer Unterstützung und Zuwendung in entsprechenden Situationen bedürfen.
Umgang mit Betroffenen
Durch die Merkmale dieser psychischen Beeinträchtigung kann der Umgang mit Betroffenen insbesondere in der Partnerschaft schwierig werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Patienten durch die nach-traumatische Reaktion auffällig aggressiv, gereizt oder sehr ängstlich reagieren.
Hilfreich kann es dann sein, sie darauf hinzuweisen, dass die Heilungschancen recht gut sind und Menschen, die eine Extrembelastung erfahren haben, zu einer Therapie zu ermutigen.
Wichtig ist es auch, die Betroffenen und ihre Gefühle ernst zu nehmen und ihnen aufmerksam zuzuhören. Bereits dies baut den Leidensdruck ab, da sich durch Verständnis wieder eine Perspektive eröffnet. Schuldzuweisungen und Anklagen sollte man vermeiden, da sich Patienten in der Regel mit ohnehin mit Schuld-Gefühlen plagen. Deswegen ist Zurückhaltung angezeigt bei gut gemeinten Ratschlägen, denn Patienten fühlen sich durch ihre Ausnahmeerfahrungen häufig unverstanden und von der Umwelt und anderen Menschen isoliert. Vor allem in einer Partnerschaft ist deswegen Geduld und Durchhaltevermögen über Wochen und Monate gefragt.
Angehörige von PTBS-Patienten berichten zum Teil, dass die Krankheit und das Erlebte zu einer Persönlichkeitsveränderung führt. Bekannt ist dies von ehemaligen Häftlingen im berühmt-berüchtigten Straflager Guantanamo auf Kuba: Entlassene Häftlinge verändern sich oft in ihrem Wesen und sind fast nicht mehr wiederzuerkennen. Kennzeichen hierfür sind zum Beispiel unkontrollierte Wutausbrüche. Das macht den Umgang mit ihnen in den Herkunftsfamilien schwierig, da insbesondere in Entwicklungsländern wie Afghanistan die Krankheit noch weitgehend unbekannt ist. In den Industrieländern weiß man inzwischen, dass beispielsweise Tiere einen positiven therapeutischen Beitrag leisten können. Insbesondere ein gutmütiger, anhänglicher und fürsorglicher Hund, ein sogenannter Assistenzhund, kann Patienten erwiesenermaßen helfen, die Krankheit besser und schneller zu überwinden. So hat man auch schon in zahlreichen Kliniken das therapeutische Angebot um Assistenzhunde erweitert, weil man damit auch die Genesung von anderen psychischen Krankheiten unterstützen möchte. Andere bekannte Verfahren mit Tieren sind die Hippotherapie (die Therapie mit Pferden) oder die Delphintherapie. Haustiere wirken sich allgemein günstig auf psychisch erkrankte Patienten aus.
Verschiedene Begriffsklärungen
► Komplexe PTBS
Der ICD 10 differenziert verschiedene Formen. So ist beispielsweise im Gegensatz zu einer sogenannten einfachen von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung („komplexe PTBS„) die Rede. Andere Begriffe sind Typ 1 und Typ 2 PTBS. Was ist darunter aber zu verstehen? Eine komplexe PTBS entsteht aus wiederholten, anhaltenden oder schweren Traumatisierungen. Die Folgen liegen auf der Hand: Soziale Beziehungen zu anderen, das Denken und Fühlen werden schwer beeinträchtigt, noch schwerer als bei der einfachen PTBS.
Laut ICD 10 ist die Voraussetzung für die Diagnose, dass die Störung mindestens seit zwei Jahren besteht. Patienten neigen zu selbstzerstörerischem Verhalten, haben Schwierigkeiten bei der Emotionskontrolle (zum Beispiel unkontrollierte und unvermittelte Wutausbrüche), haben eine Neigung zu Dissoziationen (siehe Dissoziation = Abspaltung des Bewusstseins von der Umwelt) oder verdrängen die bedrohliche Erinnerung völlig, haben oft Gefühle von Schuld und ein geringes Selbstwertgefühl, sind ausgesprochen misstrauisch und wachsam und neigen zu körperlichen Symptomen, die psychische Ursachen haben.
Aus einer unbehandelten PTBS kann sich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Häufig ist dann durch Personen aus dem näheren Umfeld eine Veränderung der Persönlichkeit festzustellen.
► Posttraumatisches Syndrom
Das Posttraumatische Syndrom ist ein anderer Ausdruck für die Posttraumatische Belastungsstörung.
► Posttraumatische Belastungsreaktion
Die Posttraumatische Belastungsreaktion ist (im Gegensatz zur akuten Belastungsreaktion, die vorübergehend ist) ebenfalls ein alternativer Fachausdruck für die Posttraumatische Belastungsstörung.
Posttraumatische Störung – Buchtipps für Fachleute
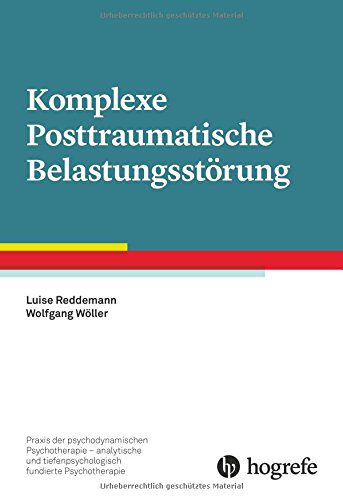
Wo finde ich Hilfe – hilfreiche Links
Wenn Sie vermuten und das Gefühl haben, dass Sie, ein Angehöriger oder ein Freund unter der Erkrankung leiden, wenden Sie sich am besten zunächst an ihren Hausarzt. Dieser kann eine erste Diagnose über das Geschehen stellen und Sie an einen Facharzt oder Psychotherapeuten verweisen. Zudem existieren im Internet Selbsthilfeforen. Beispiele:
- ptbs-dasforum.de
- paradisi.de/(…)/Posttraumatische_Belastungsstoerung/Forum/
- ptbs-hilfe.de/startseite.html
- ptbs-hilfe.de/service/ansprechpartner.html
In den meisten deutschen Großstädten sind zudem Selbsthilfegruppen zu finden.
Hilfreiche Videos über das Thema „Posttraumatische Belastungsstörungen“
YOUTUBE: Spiegel TV Reportage über Posttraumatisches Belastungssyndrom bei einem Bundeswehrsoldaten (youtube.com/watch?v=zrJWnAMjPfQ)
YOUTUBE: Posttraumatische Stresserkrankung(en): Verbitterungsstörung, PTB-Syndrom (youtube.com/watch?v=VcCe_LNhqlk)
